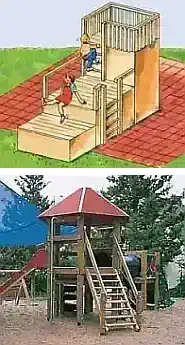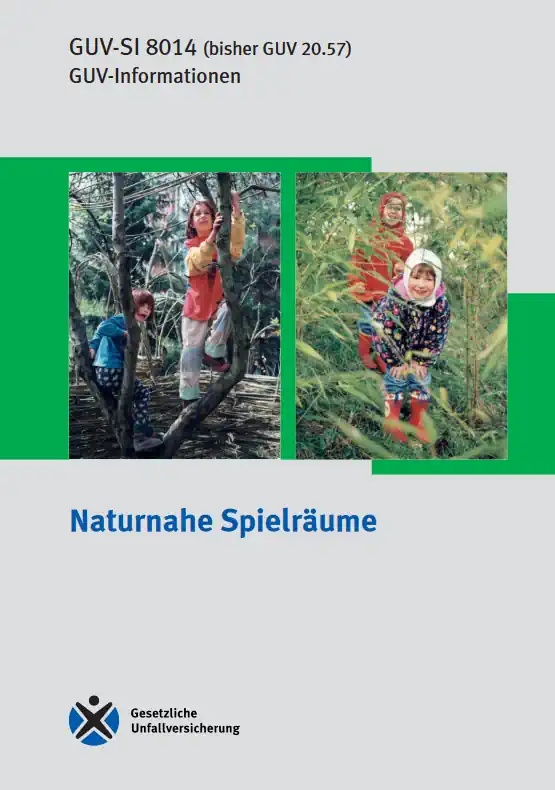02. Gestaltungskriterien für Außenflächen und Auswahl der Spielangebote
02a. Allgemeine Hinweise
Bei Spielangeboten in Kinderkrippen und -gärten ist daran zu denken, dass im Bedarfsfall Hilfestellung gegeben werden kann.
Besondere Gefährdungen für Krippenkinder sind zu vermeiden, z.B. durch Beschaffung von Spielplatzgeräten entsprechend DIN EN 1176‑1 ohne deutsche A-Abweichung.
Mehrere kleinere Angebote sind immer einer einzelnen Großanlage vorzuziehen, um das Geschehen zu entflechten.
 Beim Kauf von in Serie
gefertigten Spielplatzgeräten sollte darauf geachtet werden, dass diese mit dem Zeichen
Geprüfte Sicherheit versehen sind.
Beim Kauf von in Serie
gefertigten Spielplatzgeräten sollte darauf geachtet werden, dass diese mit dem Zeichen
Geprüfte Sicherheit versehen sind.02b. Grundsätze, Normen
Sicherheitstechnische Aussagen zu Spielplatzgeräten sind in DIN EN 1176 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden enthalten.
Die Ausführungen dieser Seite beziehen sich nicht auf Geräte, die nach DIN EN 71 Sicherheit von Spielzeug erstellt wurden und die nur für den häuslichen Bereich geeignet sind. Diese Geräte sind auf Grund der Materialwahl und/oder der Bauausführung nicht für den intensiven Alltagsbetrieb in Kitas und Schulen geeignet.
Weitere sicherheitstechnische Hinweise zu Spielplatzgeräten sind z.B. in DIN 18 034 Spielplätze und Freiräume zum Spielen; Anforderungen und Hinweise für die Planung und den Betrieb und in DIN 33 942 Barrierefreie Spielplatzgeräte aufgeführt.