04. Entwicklungspsychologische Grundlagen der
Sicherheitserziehung
04a. Denken
Die Berücksichtigung der kindlichen Denkstrukturen gehört zu den wichtigsten
Grundlagen jeder Erziehung. Gerade im Kindergartenalter sind diese einer sehr starken Entwicklung
unterworfen. Bei den jüngeren Kindergartenkindern findet man dabei Strukturen, die das Verständnis
von Sachverhalten erschweren können, trotzdem aber einen starken Einfluss auf das konkrete
Verhalten haben. Auf diese soll im nun folgenden Abschnitt eingegangen werden.
Der Schweizer Entwicklungspsychologe
Jean Piaget⮧, von dem die bisher umfassendste Theorie über die Entwicklung kognitiver
Strukturen bei Kindern stammt, unterteilt diese in vier Stadien.
Im Alter zwischen drei und sechs Jahren durchlaufen die Kinder zwei dieser
Entwicklungsstadien:
mit drei und vier Jahren befinden sie sich laut Piaget im präoperationalen
Stadium,
fünf- und sechsjährige Kinder durchlaufen das konkret-operatorische Stadium.
Auch wenn die Altersnormen nicht bei allen Kindern auf das Jahr genau stimmen (es handelt sich
hier um Mittelwerte, von denen Spät- und Frühentwickler deutlich abweichen können), so macht doch
jedes Kind im Laufe seiner Entwicklung diese Stadien durch.
Einige Denkstrukturen, die bei Kindern während des präoperationalen Stadiums auftreten,
können Maßnahmen zur Sicherheitserziehung erschweren. Diese alterstypischen Denkstrukturen sollen
im Folgenden näher behandelt werden:
Egozentrismus
Kinder im präoperationalen Stadium sind im kognitiven Bereich – im Gegensatz zum
emotionalen Bereich – unfähig, sich in andere Personen hineinzuversetzen. Sie glauben, ihre
Sichtweise der Welt sei die einzig mögliche. Dies wird durch das nachstehende Beispiel aus dem
Wahrnehmungsbereich deutlich.
Egozentrismus macht sich im Übrigen auch im kommunikativen Bereich bemerkbar. So
kann sich ein Kind nicht vorstellen, dass andere Personen etwas nicht verstehen, was es selbst
gesagt hat. Es wird daher weder etwas erläutern noch nachfragen, ob die Information vollständig
beim Gesprächspartner angekommen ist.
 Vier Jahre alten Kindern wurde
das Modell einer Landschaft gezeigt, zunächst vom Blickpunkt 1 aus. Vier Jahre alten Kindern wurde
das Modell einer Landschaft gezeigt, zunächst vom Blickpunkt 1 aus.
Sie wurden gebeten, die
Landschaft zu beschreiben.
Dies gelang allen Kindern.
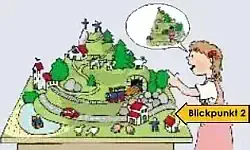 Anschließend zeigte man den Kindern die
Landschaft vom Blickpunkt 2 aus. Anschließend zeigte man den Kindern die
Landschaft vom Blickpunkt 2 aus.
Auch hier konnten die Kinder die Landschaft beschreiben.
 Führte man sie aber anschließend wieder zum
Blickpunkt 1 zurück und bat sie, die Landschaft so zu beschreiben, wie sie eine andere Person
vom Blickpunkt 2 aus sieht, war dies den Kindern nicht möglich. Führte man sie aber anschließend wieder zum
Blickpunkt 1 zurück und bat sie, die Landschaft so zu beschreiben, wie sie eine andere Person
vom Blickpunkt 2 aus sieht, war dies den Kindern nicht möglich.
Beschränkung auf nur einen Aspekt des Handlungsfeldes
Kinder im Alter von drei und vier Jahren können nur einen Aspekt einer Situation
beachten. Alle anderen Aspekte werden zunächst ignoriert. Natürlich kann der beachtete Aspekt
wechseln. Nicht möglich ist den Kindern im präoperationalen Entwicklungsstadium aber die
gleichzeitige Berücksichtigung aller Handlungsaspekte.
Auch dies kann anhand eines Beispiels
verdeutlicht werden:
 Zwei gleiche Gläser wurden mit der gleichen
Menge einer Flüssigkeit gefüllt. Zwei gleiche Gläser wurden mit der gleichen
Menge einer Flüssigkeit gefüllt.
Die Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren bestätigten, dass
die Flüssigkeitsmenge in beiden Gläsern gleich sei.
Dann wurde der
Inhalt eines der Gläser in ein schmaleres Glas umgefüllt.
Nun wurden
die Kinder erneut befragt, in welchem der Gläser sich mehr Flüssigkeit befände. Die meisten Kinder
beachteten entweder den Aspekt Höhe, d.h. sie sagten, in dem schmaleren Glas mit dem höheren
Flüssigkeitsstand sei der Inhalt größer, oder sie beachteten nur den Aspekt Breite – dann wurde der
Inhalt des niedrigen, breiten Glases als größer angesehen. Nur sehr wenigen Kindern war es möglich,
beide Aspekte zu beachten und somit zur richtigen Lösung »gleich viel Flüssigkeit« zu kommen.
Bildhaftes Denken
 Bildhaftes Denken ist nicht auf das Kindesalter
beschränkt, sondern tritt zuweilen auch bei Erwachsenen auf. Ein sehr hoher Anteil dieser Form des
Denkens ist aber ein weiteres Kennzeichen des präoperationalen Entwicklungsstadiums. Die Welt ist
für die Kinder noch nicht durch Symbole repräsentiert, sondern durch Bilder. Sichtbar wird dies,
wenn Kinder zählen sollen: Bildhaftes Denken ist nicht auf das Kindesalter
beschränkt, sondern tritt zuweilen auch bei Erwachsenen auf. Ein sehr hoher Anteil dieser Form des
Denkens ist aber ein weiteres Kennzeichen des präoperationalen Entwicklungsstadiums. Die Welt ist
für die Kinder noch nicht durch Symbole repräsentiert, sondern durch Bilder. Sichtbar wird dies,
wenn Kinder zählen sollen:
Ist die Zahl mit Gegenständen verbunden (z.B. Äpfeln oder den eigenen
Fingern), so beherrschen sie das Zählen besser als mit den (gedachten) abstrakten Zahlen. Noch
abstraktere Begriffe sind den Kindern nicht einmal vermittelbar.
Flexibilität des Denkens (Transferfähigkeit)
Das Denken der Kinder in diesem Stadium ist noch relativ wenig flexibel. Ein
Transfer von Wissen, das in einer Situation erworben wurde, auf eine neue Situation ist vielfach
nicht möglich. Dieser Transfer würde das Erkennen von abstrakten, informationsunabhängigen
Prinzipien voraussetzen.
Diese Unbeweglichkeit des Denkens gilt auch für sprachliche Informationen. Kinder merken sich zum
Beispiel Märchen oder Geschichten ganz genau. Ein Abweichen von einem einmal vorgegebenen Text wird
sofort korrigiert.
Im Alter von fünf Jahren beginnt der Übergang in das konkretoperatorische
Entwicklungsstadium. Die Kinder beginnen hier, die oben genannten Denkstrukturen zu überwinden.
Das Denken wird flexibler, es kann mehr als ein Aspekt einer Handlung beachtet werden, und es ist
den Kindern auch möglich, Dinge aus anderen Blickwinkeln als dem Eigenen zu betrachten. Das Denken
in Bildern bleibt aber teilweise noch bis in das Schulalter erhalten.
Für die Praxis der Sicherheitserziehung – insbesondere bei den jüngeren
Kindergartenkindern – ergeben sich aus den besonderen Denkstrukturen folgende Konsequenzen:
Die Kinder sind noch nicht fähig, den Standpunkt anderer Personen
einzunehmen. Das bedeutet, dass die Folgen eigener Handlungen für andere Personen nicht bedacht
werden können. So kann ein Kind zwar wissen, dass es auf einer Wasserlache auf glatten Fliesen
ausrutschen kann.
Dies bedeutet aber nicht, dass es auch die Gefahr für andere erkennt, wenn es
selbst Wasser verschüttet. Es muss daher immer damit gerechnet werden, dass Kinder trotz des
Wissens um Gefahren diese für andere nicht erkennen und beseitigen.
Die Kinder können nur jeweils einen Handlungsaspekt gleichzeitig erkennen.
Gerade Unfallabläufe bestehen aber aus einer Reihe von miteinander verknüpften Ursachen.
Versuche, diese komplexe Ursachenkonfiguration zu erklären, müssen scheitern. Es ist hingegen
sinnvoll, einen Gefahrenaspekt (vorzugsweise die einfachste und am besten darstellbare Gefahr)
herauszugreifen und zu erklären.
Eine differenziertere Darstellung ist erst bei älteren Kindern
zweckmäßig.
Das Denken der Kinder ist noch stark an Bilder gebunden.
Abstrakte Sachverhalte sind daher schlecht oder überhaupt nicht vermittelbar. Hinter vielen
Unfallgefahren stecken aber abstrakte Prinzipien, wie zum Beispiel Kräfte und Energien. Hier muss
man versuchen, Gefahren oder Unfallursachen herauszustellen, die bildhaft darstellbar sind, während
auf abstrakte Begriffe verzichtet werden sollte.
Das Denken der Kinder ist noch relativ unbeweglich. So bedeutet ein Erkennen von
Gefahren in einer bestimmten Situation (z. B. bei freihändigem Stehen auf der Rutschbahn die Gefahr
des Absturzes mit schweren Verletzungen) noch nicht, dass dies auch auf andere Situationen
übertragen wird (z. B. auf die gleiche Situation auf dem Kletterturm).
Gefahren müssen also für
jede einzelne Situation separat erklärt werden. Die Unbeweglichkeit des Denkens macht sich bei
Erklärungen oder Instruktionen bemerkbar. Oben wurde schon erwähnt, dass Kinder Märchen gerne stets
im gleichen Wortlaut hören wollen. Sie sind dadurch für die Kinder besser verständlich. Der gleiche
Mechanismus gilt auch für Hinweise auf Gefahren oder für Verhaltensinstruktionen, die man deshalb
unter Verwendung derselben Begriffe mehrfach wiederholen sollte.
Ein praktisches Beispiel
könnte folgendermaßen aussehen:
 Kinder stecken oft unbekannte Dinge wie zum
Beispiel Beeren in den Mund oder trinken auch aus unbekannten Gefäßen (z.B. Spülmittelflaschen mit
Zitronen auf dem Etikett). Kinder stecken oft unbekannte Dinge wie zum
Beispiel Beeren in den Mund oder trinken auch aus unbekannten Gefäßen (z.B. Spülmittelflaschen mit
Zitronen auf dem Etikett).
Die Jüngsten können noch nicht erkennen, ob etwas genießbar ist oder
nicht. Sie sollen daher lernen, nichts zu essen oder zu trinken, das nicht von den Erzieherinnen
oder Eltern erlaubt wurde. Um die Gefahr zu erklären, sollen die obigen Folgerungen angewandt
werden:
Essen oder Trinken von unbekannten Dingen birgt eine Vielzahl von Gefahren in sich
(Vergiftungen, Verätzungen, mangelnde Hygiene etc.). Die für das Kind Bildhafteste ist wohl das
Bauchweh (hat jeder schon einmal gehabt). Ein zweiter, den Kindern bekannter Begriff ist die
Krankheit. Selbst jüngere Kindergartenkinder assoziieren mit dem Begriff »Krankheit« zum Beispiel
Bettruhe, Übelkeit oder Fieber, die sie für sich selbst vermeiden wollen. Diese beiden Begriffe
können für eine Warnung vor den Gefahren verwendet werden, die etwa lautet: »Wenn du diese Sachen
isst (oder trinkst), die du nicht von uns bekommen hast, kannst du Bauchschmerzen bekommen und
krank werden.« Diese Erklärung müsste dann in allen entsprechenden Situationen wiederholt werden.
* Das Werk Piagets ist über 50 Jahre alt. Inzwischen
wurde es in Detailfragen durch neuere Untersuchungen ergänzt oder relativiert, in der Regel aber
bestätigt. Da keine andere Forschungsarbeit eine auch nur annähernd so umfassende Beschreibung der
kindlichen kognitiven Entwicklung bietet, soll die Arbeit Piagets trotz ihres Alters hier als
Grundlage dienen.
04b. Gedächtnis
Die Kapazität des Gedächtnisses von Kindern im Kindergartenalter unterscheidet sich
nicht grundsätzlich von dem der Erwachsenen. So ist das Kurzzeitgedächtnis schon bei Kleinkindern
voll ausgebildet: Die Kapazität (die Anzahl von Informationen, die man gleichzeitig behalten kann)
beträgt in allen Altersgruppen ca. sieben Zeichen (z.B. eine Telefonnummer). Auch bei der Kapazität
des Langzeitgedächtnisses bestehen zwischen den Altersgruppen keine Unterschiede.
Trotzdem können sich jüngere Kinder viele Dinge schlechter merken als Erwachsene. Dies liegt
daran, dass die Kinder noch nicht fähig sind, die Informationen, die auf sie einströmen, so zu
gruppieren, dass größere Mengen davon im Gedächtnis gespeichert werden können.
Erwachsene fassen ähnliche
Informationen zu Gruppen zusammen oder denken sich abstrakte Prinzipien aus, um sich die zu
merkende Information später wieder erschließen zu können. Das nachfolgende Beispiel macht dies
deutlich:
Die Strichfolge der folgenden Abbildung soll eingeprägt und behalten werden.
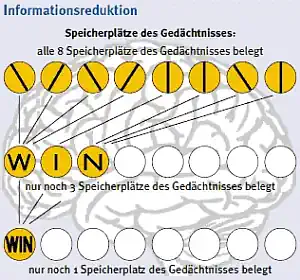 In der obersten Reihe kann man die Information ungruppiert sehen.
In der obersten Reihe kann man die Information ungruppiert sehen.
Die zu behaltende Strichfolge Erster Strich von oben links nach unten rechts, zweiter Strich
von unten links nach oben rechts etc. beansprucht viel Speicherkapazität.
Fasst man die Information aber nach einem Prinzip zusammen (z.B. zu abstrakten Zeichen), so werden
Kapazitäten frei: die Zusammenfassung zu Buchstaben in Zeile 2.
Die Möglichkeiten der Gruppierung können noch viel weiter geführt werden, wie die Zusammenfassung
zu Worten in Zeile 3 zeigt.
Die durch die gezeigte Reduktion frei werdenden Speicherplätze können zum Merken
anderer Informationen verwendet werden.
Kinder im Kindergartenalter verwenden ohne Anleitung nur die einfachsten
Gedächtnisstrategien, wie zum Beispiel das ständige Wiederholen der zu merkenden Information. Für
Erzieherinnen und Eltern besteht aber die Möglichkeit, die Kinder mit effektiveren
Gedächtnisstrategien vertraut zu machen, damit sich die Kinder wichtige Informationen besser merken
können oder damit ihr Gedächtnis allgemein verbessert wird:
 Kinder merken sich Dinge besser, wenn sie wissen, dass sie etwas behalten sollen.
Kinder erinnern sich auch besser, wenn sie die Möglichkeit haben, die Dinge, die sie sich merken
sollen, zu betasten.
Auch wenn Kinder von sich aus keine Gruppierungen von Informationen vornehmen, können sie von
außen gegebene Oberbegriffe doch nutzen.
Kinder besitzen bereits die Fähigkeit, sich durch Wiederholen von Informationen diese besser
einzuprägen. Diese Fähigkeit wird allerdings nicht auf alle Informationen angewandt.
Kinder behalten Informationen besser, die in Spielhandlungen eingebaut sind. Diese
Tatsache soll durch ein kleines Experiment verdeutlicht werden:
Kinder merken sich Dinge besser, wenn sie wissen, dass sie etwas behalten sollen.
Kinder erinnern sich auch besser, wenn sie die Möglichkeit haben, die Dinge, die sie sich merken
sollen, zu betasten.
Auch wenn Kinder von sich aus keine Gruppierungen von Informationen vornehmen, können sie von
außen gegebene Oberbegriffe doch nutzen.
Kinder besitzen bereits die Fähigkeit, sich durch Wiederholen von Informationen diese besser
einzuprägen. Diese Fähigkeit wird allerdings nicht auf alle Informationen angewandt.
Kinder behalten Informationen besser, die in Spielhandlungen eingebaut sind. Diese
Tatsache soll durch ein kleines Experiment verdeutlicht werden:
 Zwei Kindergruppen im Vorschulalter sollten sich eine Liste von Gegenständen merken.
Zwei Kindergruppen im Vorschulalter sollten sich eine Liste von Gegenständen merken.
Der ersten Gruppe wurde gesagt, dass sie sich die Gegenstände merken sollte.
Anschließend wurde die Liste verlesen. Nach einiger Zeit wurden die Kinder aufgefordert zu sagen,
was sie noch behalten haben.
Die Kinder der zweiten Gruppe sollten sich eine vergleichbare Liste
von Gegenständen (hier Lebensmittel) merken. Die Gedächtnisaufgabe war hier aber in ein Spiel
eingebettet. Die Gegenstände der Liste sollten in einem Kinderkaufladen eingekauft werden.
Die zweite Gruppe merkte sich über doppelt so viele Begriffe wie die erste Gruppe und wandte mehr
Gedächtnisstrategien an. Dieses Experiment wird als Beleg dafür angesehen, dass die Verwendung von
Gedächtnisstrategien davon abhängt, ob das Kind es auf Grund seines individuellen Zusammenhangs als
sinnvoll ansieht, sich so viele Informationen zu merken.
Für die Arbeit im
Kindergarten ergeben sich folgende Notwendigkeiten:
Wichtige Informationen (z.B. über akute Gefahren) müssen von der Erzieherin immer
wieder genannt werden (am besten im gleichen Wortlaut). Wichtig ist auch, dass die Kinder die
Informationen selbst wiederholen.
Bei der Einführung von großen Mengen neuer Begriffe sollte überlegt werden, nach
welchen Oberbegriffen diese geordnet werden könnten. Diese Oberbegriffe können die Kinder dann dazu
verwenden, um sich die neuen Begriffe besser einzuprägen.
Da der Hinweis, dass ein Begriff gemerkt werden soll, die
Behaltensleistung erhöht, ist es notwendig, bei wichtigen Informationen dies auch zu
sagen.
Wenn es sich bei den zu merkenden Begriffen um Gegenstände handelt, sollten diese
den Kindern gezeigt werden und ihnen die Gelegenheit gegeben werden, die Gegenstände zu
betasten.
Eine der besten Möglichkeiten, die Gedächtnisleistung zu erhöhen, ist die
Einbettung der zu merkenden Informationen in eine SPIELHANDLUNG. Diese Strategie lässt sich im
Kindergarten besonders gut durchführen. So können zum Beispiel Rollenspiele dazu verwendet werden,
das Verhalten in gefährlichen Situationen durchzuspielen und dabei bestimmte
Verhaltensanforderungen zu lernen und dauerhaft zu behalten.
Die obigen Möglichkeiten könnten zum Beispiel in folgender Situation angewandt
werden:
In Sandkästen (besonders von öffentlichen Spielplätzen) finden sich häufig scharfe
oder stechende Gegenstände, wie Glasscherben, Spritzen, Blechteile etc. Damit sich die Kinder diese
Gegenstände besser merken, ist die Einführung eines Oberbegriffs, z.B. »Sachen, an denen man sich
schneiden oder stechen kann«, sinnvoll. Mit Hilfe dieses Oberbegriffs kann dann
Vermeidungsverhalten gelernt werden.
Die Merkfähigkeit der Kinder, welche Dinge zu den schneidenden oder stechenden
Sachen gehören, kann zum Beispiel durch ein kleines Kreisspiel vertieft werden:
 Die Patienten sitzen im Kreis (Wartezimmer), ein Kind in der Mitte ist der Doktor, der die Wunden
seiner Patienten (mit Binden aus dem Kinder-Arztkoffer) versorgen soll.
Die Patienten sitzen im Kreis (Wartezimmer), ein Kind in der Mitte ist der Doktor, der die Wunden
seiner Patienten (mit Binden aus dem Kinder-Arztkoffer) versorgen soll.
Jedes Kind bekommt vorher von der Erzieherin einen Gegenstand gesagt, an dem es sich geschnitten
haben soll (Glasscherbe, scharfes Messer, Aufreißlasche von Getränkedosen). Bei älteren Kindern
kann der Gegenstand mitgebracht werden und vorsichtig betastet werden.
Da bei solchen Spielen
Wiederholungen sinnvoll sind, wird das Spiel bald darauf nochmals gespielt. Nun geben die Kinder
die Gegenstände aber schon selbstständig an.
04c. Sprache
Grundlage jeder Erklärung und jeder sonstigen Weitergabe von komplexen Informationen
ist die Sprache.
Im Kindergartenalter ist die Fähigkeit, korrekt zu sprechen und Erwachsene zu verstehen, noch
nicht völlig vorhanden. Aus diesem Grund muss – gerade bei der Erklärung lebenswichtiger
Sachverhalte wie der Sicherheitserziehung – das kindliche Sprachverständnis berücksichtigt werden,
um Missverständnisse zu vermeiden.
In diesem Zusammenhang sind primär zwei Phänomene zu beachten:
Kinder unter fünf Jahren verstehen Passivsätze anders als Erwachsene. Sie
folgen meistens noch eher der »Oberflächenstruktur« des Satzes; das im Satz erstgenannte Nomen wird
als Subjekt, das als letztes Genannte als Objekt verstanden. Hierdurch kann es zu einer
Umkehrung des Satzsinnes kommen!
 Hierzu ein Beispiel: Hierzu ein Beispiel:
Hans wird von Fritz gehauen) wird von Kindergartenkindern verstanden als
Hans haut Fritz.
Nach der Oberflächenstruktur des Satzes steht das Nomen Hans als erstes und
wird damit zum Subjekt, während Fritz als letztes Nomen zum Objekt wird.
Nur wenn Kinder einen Sachverhalt genau wissen, werden auch Passivsätze richtig
verstanden.
Auch hierzu ein Beispiel:
Die Maus wird von der Katze gefressen lautet nach
der Oberflächenstruktur
Die Maus frisst die Katze.
Da aber die Kinder wissen, dass Katzen Mäuse fressen und nicht umgekehrt, verstehen sie
Die Katze frisst die Maus.
Erklärungen von Gefahren bauen nur selten auf bereits vorhandenem Wissen der Kinder auf. Aus
diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass die Kinder bei vielen Passivsätzen einen falschen Sinn
verstehen.
Wie bereits im Kapitel
Denken⮥ beschrieben, ist das Denken
der Kinder im Kindergartenalter noch sehr stark an Bilder gebunden. Daher verwundert es nicht, dass
die Kinder noch keine sprachlichen Metaphern (bildhafte Ausdrücke) verstehen können. Bei diesen
steckt hinter dem Wort selbst noch eine weitere Bedeutung – quasi auf höherer Ebene.
 Auch hierzu ein Beispiel: Auch hierzu ein Beispiel:
Der Rost hat den Pfosten der Schaukel zerfressen ist für die Kinder
unglaubwürdig, da nach ihrem (bildhaften) Denken zum Zerfressen ZÄHNE notwendig sind, die der Rost
eben nicht hat.
Neben dem vorher beschriebenen Verständnis der Sprache selbst ist für jede Art
Erziehung auch die Funktion der Sprache bei der Handlungsregulierung wichtig. Darunter
versteht man die Fähigkeit, sich bei gestellten Aufgaben die Instruktion selbst geben zu können.
Diese Fähigkeit ist bei drei- bis vierjährigen Kindern noch nicht vorhanden. Sprache dient bei
diesen Kindern nur als Impuls – die Handlung erfolgt unabhängig vom Inhalt der Sprache.
Dazu ein Beispiel:
In einem Versuch sollten Kinder verschiedener
Altersgruppen auf ein Lichtsignal hin einen Gummiball drücken. Ein rotes Licht bedeutete »drücken«,
ein Grünes hingegen »nicht drücken«. Dabei sollte jeweils gesagt werden, was zu tun sei. Kinder im
Alter von drei und vier Jahren waren durchaus fähig, sich richtig zu instruieren (bei rotem Licht
sagten sie »drücken«, bei grünem Licht »nicht drücken«). Bei dieser Altersgruppe war aber die
sprachliche Instruktion nicht handlungsregulierend: auch wenn sie »nicht drücken« sagten, drückten
sie den Ball. Die Sprache war hier nur Impuls zu einer Handlung – unabhängig vom Sprachinhalt.
Erst Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren verwendeten auch den Sprachinhalt: wenn sie sagten
»nicht drücken«, drückten sie nicht.
Für die pädagogische Arbeit ist im Zusammenhang mit der kindlichen
Sprachentwicklung Folgendes zu beachten:
Bei allen Erklärungen, die für das Kind von Wichtigkeit sind, sollte man
versuchen, auf Passivsätze zu verzichten. Es besteht die Gefahr, dass die Kinder bei diesen einen
entgegengesetzten Sinn verstehen.
Metaphern sind für Kinder im Kindergartenalter ebenfalls noch unverständlich. Man
sollte sie vermeiden.
Bei jüngeren Kindern muss damit gerechnet werden, dass sie – obwohl sie den
Inhalt von Instruktionen bereits verstehen – diese lediglich als Impuls für Handlungen sehen, die
der Instruktion nicht unbedingt entsprechen.
Diese Besonderheit lässt sich nur durch erhöhte
Aufsicht der Erzieherinnen ausgleichen.
Ein Anwendungsbeispiel wäre
zum Beispiel folgende Situation:
Kinder erforschen gerne mit Hilfe von Nägeln u.ä. Ritzen, Höhlungen oder Löcher.
Eine Gefahr ist dabei, dass sie Gegenstände in nicht kindergesicherte Steckdosen stecken. Um die
Kinder auf die Gefährlichkeit solcher Handlungen hinzuweisen, wird zum Beispiel häufig gesagt, die
Kinder sollten damit aufhören, sie würden sonst vom Schlag getroffen. In einer solchen – nicht
seltenen – Warnung steckt sowohl eine Passivkonstruktion als auch eine Metapher (vom Schlag
getroffen werden). Besser ist hier zum Beispiel die Erklärung: »Hör auf, Sachen in die
Dose zu stecken, da kannst du dir so wehtun, dass du daran sterben kannst.« Optimal wäre
allerdings die Erhöhung der technischen Sicherheit durch Anschaffung von Kindersicherungen.
04d. Beurteilungsvermögen
Die Fähigkeit, etwas als »richtig« oder »falsch«, als »gut« oder »schlecht« beurteilen
zu können, ist für das sicherheitsbewusste Verhalten von großer Bedeutung – insbesondere dann, wenn
das Verhalten der Kinder von anderen (z.B. älteren Kindern) beeinflusst wird. Ob deren Handeln
imitiert wird, hängt nicht zuletzt davon ab, ob es in Übereinstimmung mit den eigenen moralischen
Werten der Kinder steht.
Eine entwicklungsbedingte Eigenart der Kinder ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig:
Im Abschnitt Denken⮥ wurde bereits die
mangelnde Fähigkeit der Kinder zwischen drei und sechs Jahren beschrieben, mehr als einen Aspekt
einer Situation zu berücksichtigen. Dies gilt auch für moralische Urteile.
Kinder im Alter bis zu fünf Jahren können eine Handlung moralisch nur entweder
anhand der Intention oder des Handlungsausgangs bewerten. Meistens wählen sie den (konkret
fassbareren) Handlungsausgang. Hierzu ein Beispiel von Piaget:
Einer Kindergruppe (Alter drei bis vier Jahre)
wurden zwei Geschichten erzählt. Anschließend bat man sie zu beurteilen, welche der Hauptfiguren
moralisch negativer zu beurteilen sei.
 In der ersten Geschichte sieht ein Junge die
Mutter spülen und möchte ihr helfen. Dabei zerbrechen ihm versehentlich zehn Tassen. Der Junge in
der zweiten Geschichte wird von seiner Mutter gebeten, ihr zu helfen. Er hat aber keine Lust und
zerbricht aus Wut eine Tasse. In der ersten Geschichte sieht ein Junge die
Mutter spülen und möchte ihr helfen. Dabei zerbrechen ihm versehentlich zehn Tassen. Der Junge in
der zweiten Geschichte wird von seiner Mutter gebeten, ihr zu helfen. Er hat aber keine Lust und
zerbricht aus Wut eine Tasse.
Die meisten der befragten Kinder bewerteten
ausschließlich den Handlungsausgang (hier den größeren Schaden), der erste Junge wurde daher
negativer beurteilt als der Zweite.
Im Zusammenhang mit dem Handlungsausgang ist noch eine andere Beobachtung wichtig:
Kinder erleben einen Unfall erst als »wirklichen« Unfall, wenn er sichtbare Folgen wie Verletzungen
hat. Je stärker Folgen für das Kind sichtbar und erkennbar sind, desto eher wird es einen Unfall
als solchen ernst nehmen. Ein »Beinahe-Unfall« wird also nicht als richtiger Unfall gewertet.
Aus den oben beschriebenen Eigenarten der Kinder kann für die praktische Arbeit
gefolgert werden:
Wenn der Handlungsausgang bei der Beurteilung von Unfällen für die Kinder eine so
große Rolle spielt, so sollte er zum Beispiel bei der Besprechung eines aktuellen Unfalls deutlich
herausgestellt werden. Es sollte dabei vermieden werden, die Kinder mit einer allzu deutlichen
Unfalldarstellung zu erschrecken; als mögliche Strategien bieten sich aber Hinweise auf
Unfallfolgen wie Schmerzen, Arzt- oder Krankenhausbehandlungen sowie Unfallschilderungen durch den
Verunfallten selbst an. Auch bei Erklärungen von Gefahren allgemein kann auf vorangegangene Unfälle
und ihre Folgen eingegangen werden: »Mit nassen Gummistiefeln ist es sehr gefährlich,
auf das Klettergerüst zu steigen. Da kann man von den Stangen abrutschen und runterfallen, so wie
damals der Markus – der hat sich sogar ein Bein gebrochen und durfte lange nicht in den
Kindergarten.«
04e. Wahrnehmung
Die Wahrnehmung ist ein wichtiger Aspekt jeder menschlichen Entwicklung. Von
ihrer Qualität hängen Lernprozesse ebenso ab wie das Verhalten – insbesondere in neuen oder
komplexen Situationen.
In den ersten drei Lebensjahren entwickeln sich die Wahrnehmungsleistungen
sprunghaft. Sie unterscheiden sich aber immer noch in wichtigen Fähigkeiten von denen Erwachsener.
Diese Fähigkeiten sowie ihre Bedeutung für das Verhalten der Kinder in kritischen Situationen sind
Thema dieses Abschnitts:
Der Schwerpunkt der visuellen Wahrnehmung von Kindern zwischen drei und
sechs Jahren liegt im Nahbereich. Zwar können sie auch weiter entfernte Objekte mit Blicken
verfolgen, sie zeigen diese Fähigkeit aber relativ selten, da ihre Aufmerksamkeit sich primär auf
den Nahbereich bezieht.
Das Blickfeld der Kinder ist kleiner
als das Erwachsener, ihre Blickposition auf Grund ihrer Größe niedriger. Bei den Drei- und
Vierjährigen ist auch die Tiefenwahrnehmung (die Fähigkeit, die Distanz zu entfernten
Objekten abzuschätzen) noch wenig entwickelt.
Um ein klares, eindeutiges Bild von der Umwelt zu erhalten, werden beim Erwachsenen einzelne
Wahrnehmungseindrücke im Gehirn nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten zu einem Gesamtbild
zusammengesetzt. Kinder im Kindergartenalter sind dazu noch nicht fähig. Sie sehen nur – möglichst
auffällige – einzelne Aspekte einer Situation, nicht das Gesamtbild. Dies wurde auch durch die
Beobachtung von Augenbewegungen bestätigt: Während Erwachsene ein Bild systematisch erkunden,
bleiben die Augenbewegungen der Kinder unsystematisch, schweifen oft ziellos umher und verharren
dann lange auf auffälligen, aber unwichtigen Details. Die Geschwindigkeit des »Abtastens« mit den
Augen ist zudem langsamer als bei Erwachsenen.
Die starke Fixierung
auf Details bei gleichzeitiger Vernachlässigung des Gesamtbilds führt unter anderem dazu, dass
teilweise verdeckte oder unvollständige Gegenstände nur schwer erkannt werden.
Die gerade genannten Besonderheiten in der Wahrnehmung sind vor allem
beim Spielen mit vielen Kindern sowie für das Verhalten im Straßenverkehr bedeutsam. So wird zur
Einschätzung von Situationen (z.B. bei Laufspielen oder beim Rad- und Rollerfahren) die Fähigkeit
benötigt, schnell die Position, Richtung und Geschwindigkeit aller Spielteilnehmer zu erkennen.
Ähnliches gilt für Situationen im Straßenverkehr. Dort – insbesondere von der Blickposition der
Kinder aus – verdecken sich viele Verkehrsteilnehmer gegenseitig. Dies kann ebenfalls zum
»Übersehen« wichtiger Details führen. Durch das engere Gesichtsfeld und die Bevorzugung des Sehens
im Nahbereich ist zudem der notwendige Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern erschwert.
Kinder im Kindergartenalter haben eine andere Betrachtungsweise von Bildmaterial als Erwachsene.
Dies soll anhand zweier kleiner Versuche näher erläutert werden:
Im ersten Versuch wurden Kindern zwischen fünf und zehn Jahren und
Erwachsenen verschiedene Fotos von ihnen bekannten Gegenständen gezeigt. Sie sollten jeweils das
Foto auswählen, das die Gegenstände am besten repräsentiert. Ältere Kinder und Erwachsene wählten
meist Totalansichten der Gegenstände. Fünf- und Sechsjährige suchten dagegen Aufnahmen ihrer
Meinung nach charakteristischer Details aus (z.B. einzelne gemalte Blümchen aus dem Muster einer
Tasse an Stelle der gesamten Tasse).
In einem zweiten Versuch zeigte
man Kindern Fotos von ihnen bekannten Gegenständen in verschiedenen Schärfen. Die Kinder sollten
sagen, welcher Gegenstand abgebildet sei. Jüngere Kinder konnten bei unscharfer Darbietung die
Gegenstände nicht oder nur schwer erkennen, während dies älteren keine Probleme bereitete. Wurden
Gegenstände aus Positionen fotografiert, die für die Kinder ungewohnt waren, so wurden sie von den
jüngeren Kindern nicht erkannt.
 Bildmaterialien sind bei allen Erklärungen
(u.a. auch von Gefahren) sehr populär. Es ist aber sehr fraglich, ob gerade jüngere
Kindergartenkinder von solchen Materialien profitieren. Besser ist es, wenn der Gegenstand, der
vorgestellt werden soll, in natura dargeboten wird: Durch die Möglichkeit des Betastens steigt die
Wahrscheinlichkeit eines späteren Wiedererkennens stark an. Bildmaterialien sind bei allen Erklärungen
(u.a. auch von Gefahren) sehr populär. Es ist aber sehr fraglich, ob gerade jüngere
Kindergartenkinder von solchen Materialien profitieren. Besser ist es, wenn der Gegenstand, der
vorgestellt werden soll, in natura dargeboten wird: Durch die Möglichkeit des Betastens steigt die
Wahrscheinlichkeit eines späteren Wiedererkennens stark an.
Im Gegensatz zu vielen früheren Untersuchungen geht man heute davon aus, dass selbst Kinder im
Kindergartenalter eine Vorstellung von Geschwindigkeit besitzen. Dies gilt aber nur für lineare,
gleichförmige Geschwindigkeiten. Bestätigt wurde hingegen auch in neueren Untersuchungen, dass die
Kinder Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge noch nicht adäquat erfassen können.
In einer anderen Untersuchungsreihe wurde
die Bewegungswahrnehmung untersucht. Den Kindern wurde ein Tennisball im Flug gezeigt. Sie
sollten angeben, wo dieser im Feld aufkommen würde. Jüngere Kinder verschätzten sich dabei stark.
Es zeigte sich aber, dass die Fähigkeit, Bewegungen richtig wahrzunehmen, übungsabhängig ist.
Die richtige Wahrnehmung von Bewegungen ist für viele Lebensbereiche der
Kinder wichtig: Beim Spiel wird diese Fähigkeit, zum Beispiel zur Vermeidung von Zusammenstößen
oder zum rechtzeitigen Ausweichen vor Wurfgeschossen, benötigt. Auch im Straßenverkehr kommen sehr
häufig nichtlineare Bewegungen vor: So müssen Kinder vor der Überquerung des Zebrastreifens
einschätzen, ob ein Fahrzeug abbremst oder nicht.
Für die Praxis in Kindergarten und Elternhaus ergibt sich aus der spezifischen
Wahrnehmung der Kinder zwischen drei und sechs Jahren Folgendes:
Erklärungen mit Unterstützung durch Bildmaterial sind immer besser als rein
verbale Erklärungen. Es muss aber darauf geachtet werden, dass Kinder eine andere Betrachtungsweise
von Bildern haben. So ist es zum Beispiel sinnvoll, die Kinder auf charakteristische Details
aufmerksam zu machen. Bilder, die Gegenstände aus ungewohnten Perspektiven zeigen, sollten bei den
jüngeren Kindern ebenso wenig eingesetzt werden wie schematische Zeichnungen.
Da die Wahrnehmung von Bewegungen übungsabhängig ist, kann diese – für
Kindergarten, Freizeit und Straßenverkehr wichtige – Fähigkeit durch Bewegungsspiele gefördert
werden.
Siehe Abschnitt 3c⮥
04f. Imitationslernen und Verhaltensgewohnheiten
Die Einschätzung einer Situation hängt entscheidend vom Wissen über
Handlungsmöglichkeiten, aber auch über Gefahren und Risiken dieser Situation ab. Dieses Wissen wird
über Lernprozesse vermittelt. Richtiges Lernen von wichtigen Informationen stellt daher ein Element
jeder Sicherheitserziehung dar.
Je nach Alter werden verschiedene Lernarten eingesetzt. Im Kindergartenalter dominiert das
Imitationslernen und das Lernen durch Verstärkung, das für die Bildung von sicheren und unsicheren
Verhaltensgewohnheiten verantwortlich ist. Die beste Lernart, das Lernen durch Einsicht (Transfer
von Wissen auf neue Situationen), verlangt eine größere Flexibilität des Denkens, findet sich daher
in der Regel erst bei älteren Kindern. Aus diesem Grund sollen hier nur die beiden ersten
Lernformen näher beleuchtet werden.
Bei der ersten, für Kinder im Kindergartenalter wichtigen Lernform handelt es sich um das
Imitationslernen (Lernen am Modell). Bei diesem Lernen wird vom Kind das Verhalten einer
anderen Person (Modell) zunächst beobachtet und sich eingeprägt. In einer vergleichbaren Situation
reproduziert dann das Kind das beobachtete Verhalten.
Beispiel für Imitationslernen
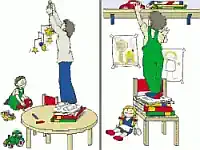 Im abgebildeten Beispiel beachtet die
Erzieherin nicht, dass das spielende Kind sie beobachtet, als sie für die Befestigung eines Mobiles
nicht die Leiter benutzt, sondern sich auf eine unsichere Unterlage stellt. Das Kind hat diese
Möglichkeit nun registriert. Im abgebildeten Beispiel beachtet die
Erzieherin nicht, dass das spielende Kind sie beobachtet, als sie für die Befestigung eines Mobiles
nicht die Leiter benutzt, sondern sich auf eine unsichere Unterlage stellt. Das Kind hat diese
Möglichkeit nun registriert.
Einige Tage später hat es ebenfalls
Probleme, einen Gegenstand außerhalb seiner Reichweite zu ergreifen. Hier setzt dann der
Imitationsprozess ein: Es wird ebenfalls eine unsichere Unterlage gewählt.
Die Übernahme von Verhalten durch Imitation hängt von mehreren Faktoren ab:
Modelle, die für den Beobachter einen hohen Status besitzen, werden stärker nachgeahmt als
Modelle mit niedrigerem Status.
Dies gilt insbesondere, wenn der Beobachter eine positive emotionale Beziehung zu dem Modell hat.
Für Kindergartenkinder sind beide Bedingungen (emotionale Beziehung und höherer Status) bei den
Eltern und älteren Geschwistern, aber auch bei den Erzieherinnen der Kindergartengruppe erfüllt.
Andere starke Modelle sind ältere Freunde (z.B. Hortkinder).
Weitere Faktoren, die Imitationsprozesse fördern, sind Alter und Fähigkeiten des beobachteten
Modells sowie Ängstlichkeit oder Abhängigkeit des Beobachters.
Für die praktische
Sicherheitsförderung im Kindergarten ergeben sich als Konsequenzen:
Die Personen, die am stärksten imitiert werden, sollten sich (zumindest) im
Beisein der Kinder sicherheitsbewusst verhalten. Für die Beschäftigten der Kindergärten ist dies
mit einiger Übung und entsprechender Ausstattung der Einrichtung leistbar, zum Beispiel beim
Hochsteigen die Leiter zu benutzen.
Schwieriger ist es schon, ältere Kinder (z.B. aus dem im gleichen Gebäude
untergebrachten Hort) entsprechend zu beeinflussen.
Die wichtigsten »Modelle« sind die Eltern. Gerade bei diesen ist es unerlässlich,
dass auch Eile und der tägliche Stress nicht dazu führen, im Beisein der Kinder riskante Dinge zu
tun (z.B. in Strümpfen auf glatten Fliesen laufen, Messer ablecken). Mit derartigem Verhalten
(selbst wenn es nur selten vorkommt) können die Bemühungen der Beschäftigten der Kindergärten,
sicheres Verhalten der Kinderzu fördern, in Frage gestellt werden.
Aus diesem Grund ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und
Elternhaus unerlässlich. Neben den Gesprächen beim Bringen und Abholen der Kinder bieten sich
hierfür vor allem Elternabende an. Bei deren Organisation und Durchführung sollten folgende Punkte
beachtet werden:
- Bei der Terminplanung müssen eventuelle parallele Veranstaltungen (auch beliebte
Fernsehserien oder Sportübertragungen) berücksichtigt werden:
- Wichtig ist die Offenlegung des pädagogischen Konzeptes der Kita zur Sicherheitsförderung
und zur Verkehrserziehung. Nur so ist eine wirksame Zusammenarbeit mit den Eltern möglich.
- Die Eltern sollten regelmäßig über das Unfallgeschehen im Kindergarten informiert werden. In
vielen Fällen konnten durch Elterninitiativen (Selbsthilfe, Spenden) kleinere bauliche Mängel
beseitigt werden.
- Die Einladung eines »Spezialisten«, wie zum Beispiel eines Mitarbeiters oder einer
Mitarbeiterin der Präventionsabteilung des zuständigen Unfallversicherungsträgers oder der
Abteilung Verkehrserziehung der Polizei, ist bei den Themen der Sicherheitsförderung und der
Verkehrserziehung zu empfehlen.
- Filme ermöglichen einen guten Einstieg in ein Thema wie die Sicherheitsförderung. Sie können
entweder beim zuständigen Unfallversicherungsträger oder bei der Landesfilmstelle entliehen
werden.
Ein einmal gezeigtes imitiertes unsicheres Verhalten der Kinder birgt zwar Gefahren,
geht aber in den meisten Fällen gut aus.
Problematisch wird es jedoch, wenn sich aus dem
einmaligen unsicheren Handeln eine unsichere Verhaltensgewohnheit entwickelt.
Der größte Teil menschlichen Verhaltens läuft gewohnheitsmäßig ab. Hier wird nicht mehr über
jeden neuen Handgriff nachgedacht (und dabei auch die Risiken abgewogen); vielmehr ist ein
bestimmtes Handlungsmuster »in Fleisch und Blut übergegangen«. Verhaltensgewohnheiten treten häufig
auf und laufen unbewusst ab. Daher stellt ihre Beeinflussung einen Schwerpunkt jeder
Sicherheitserziehung dar. Da viele Verhaltensgewohnheiten schon im Kindergartenalter erworben
werden, wollen wir nachfolgend den Mechanismus des Erwerbs näher behandeln.
Grundlage jeder Verhaltensgewohnheit ist ein einmal gezeigtes, bewusstes Handeln.
Die Konsequenz dieses Handelns entscheidet dann darüber, ob es wieder aufgegeben oder wiederholt
wird. Bringt das Verhalten dem Handelnden oder einem beobachteten Modell wiederholt Erfolg
(positive Verstärkung), ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es gewohnheitsmäßig gezeigt wird.
Dies soll anhand eines Beispiels demonstriert werden:
 Das abgebildete Kind weiß aus dem Kindergarten,
dass es die Rutschbahn nur sitzend hinabrutschen soll. Das abgebildete Kind weiß aus dem Kindergarten,
dass es die Rutschbahn nur sitzend hinabrutschen soll.
Beim Spielen nachmittags auf einem öffentlichen Spielplatz rutschen ältere Kinder auf dem Bauch
liegend hinab. Sie erzählen dem Kind, wie aufregend dies sei und verspotten es, als es nicht so
rutschen will.
Die sichere Art zu rutschen ist hier also mit Nachteilen verbunden.
 Das Kind versucht daraufhin einmal probeweise
das Rutschen auf dem Bauch. Es erleidet keinen Unfall, sondern landet weich im Sand. Das Rutschen
sorgt für etwas »Nervenkitzel«; zudem fühlt es sich mutig und anderen Kindern, die nicht so
rutschen wollen, überlegen. Das Kind versucht daraufhin einmal probeweise
das Rutschen auf dem Bauch. Es erleidet keinen Unfall, sondern landet weich im Sand. Das Rutschen
sorgt für etwas »Nervenkitzel«; zudem fühlt es sich mutig und anderen Kindern, die nicht so
rutschen wollen, überlegen.
Ein unsicheres Verhalten hatte hier Erfolg.
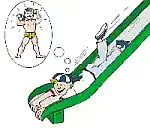 Der Erfolg führt dazu, dass das unsichere
Verhalten »auf dem Bauch die Rutschbahn hinabzurutschen« häufiger gezeigt wird – sich unter
Umständen sogar zu einer Gewohnheit entwickelt. Der Erfolg führt dazu, dass das unsichere
Verhalten »auf dem Bauch die Rutschbahn hinabzurutschen« häufiger gezeigt wird – sich unter
Umständen sogar zu einer Gewohnheit entwickelt.
Erleidet das Kind hingegen einen Unfall oder hat
das unsichere Verhalten sonst negative Folgen, wird das Rutschen auf dem Bauch eventuell wieder
aufgegeben. Unfälle sind aber so selten, dass häufig die unsichere Gewohnheit beibehalten wird.
Der Erwerb von Verhaltensgewohnheiten über
Lernprozesse kann aber auch zu sicheren Verhaltensgewohnheiten führen.
Grundlage hierfür ist
eine höhere Attraktivität des sicheren gegenüber dem unsicheren Verhalten.
Die oben gezeigten Mechanismen kann man für die Sicherheitserziehung nutzen:
Spontan auftretendes sicheres Verhalten der Kinder muss immer unterstützt werden
(etwa durch Lob und Anerkennung oder auch durch materielle Anreize). Spielen Kinder ein sicheres
Spiel gern, kann man es häufiger anbieten.
Unsicheres Verhalten – auch einzelner Kinder – darf nicht ignoriert werden.
Hier empfiehlt sich der Hinweis auf frühere Unfälle im Kindergarten, die ein solches Verhalten als
Ursache hatten. Bei riskanten, aber beliebten Spielen kann versucht werden, die Risiken zu
minimieren, die Spielidee jedoch beizubehalten. Hierzu ein Beispiel:
Häufig fahren die Kinder auf dem Hof mit Rollern, Rädern und Dreirädern frei
umher. Dadurch kommt es immer wieder zu Zusammenstößen. Dieses Spiel kann durch das Aufmalen eines
Parcours auf dem Boden »entschärft« werden. Zusätzlich kann die Regel eingeführt werden, dass
Kinder, die die »Straßen« verlassen und über »Häuser« fahren, ihr Fahrzeug an ein anderes Kind
abgeben müssen. Ein solcher Parcours eignet sich auch als Grundlage für Verkehrs-Rollenspiele.
Kinder sollten auf keinen Fall von jeder – auch noch so geringen – Gefahr fern
gehalten werden (»in Watte packen«).
Vielmehr sollen sie im Schutz der Erwachsenen lernen, mit
den alltäglichen Gefahren umzugehen. Das Lernen des Umgangs mit den Gefahren kann zwar zu
Misserfolgen führen. Gerade aber diese Misserfolge können das Verhalten des Kindes in einer Weise
beeinflussen, dass sich sichere Verhaltensgewohnheiten entwickeln. Dadurch können oft spätere
schwerwiegende Unfälle vermieden werden. Ein solches »Heranführen« ist selbstverständlich
nur bei solchen Gefahren möglich, die zu keinen ernsten Schäden führen können.
Dies ist beispielsweise beim Erwerb von Geschicklichkeit beim Klettern möglich.
 Die ungefährlichste Art zu klettern ist die auf
dem Spielplatz auf niedrigen Klettergeräten, die über Fallschutzplatten montiert sind. Stürze sind
hier möglich, bleiben aber ohne ernste Folgen und zeigen dem Kind seine Fehler beim Klettern auf.
Haben die Kinder eine gewisse Geschicklichkeit erworben, kann auch einmal eine schwierigere (oft
äußerst attraktive) Aufgabe in Angriff genommen werden, zum Beispiel das Erklettern eines niedrigen
Obstbaums, der von Wiesen- oder Humusboden umgeben ist. Sind die Kinder motorisch geschickt, und
ist eine Erzieherin oder ein Elternteil in der Nähe, die im Falle von Angst eingreifen können, so
bleibt auch hier das Risiko kalkulierbar. Die ungefährlichste Art zu klettern ist die auf
dem Spielplatz auf niedrigen Klettergeräten, die über Fallschutzplatten montiert sind. Stürze sind
hier möglich, bleiben aber ohne ernste Folgen und zeigen dem Kind seine Fehler beim Klettern auf.
Haben die Kinder eine gewisse Geschicklichkeit erworben, kann auch einmal eine schwierigere (oft
äußerst attraktive) Aufgabe in Angriff genommen werden, zum Beispiel das Erklettern eines niedrigen
Obstbaums, der von Wiesen- oder Humusboden umgeben ist. Sind die Kinder motorisch geschickt, und
ist eine Erzieherin oder ein Elternteil in der Nähe, die im Falle von Angst eingreifen können, so
bleibt auch hier das Risiko kalkulierbar.
04g. Verhaltenssteuerung und Aufmerksamkeit
Die Verhaltenssteuerung der Kinder im Kindergartenalter unterscheidet sich sehr
stark von der der meisten Erwachsenen. Gerade in diesem Alter orientiert sich Verhalten noch vor
allem am Lustprinzip. Die Fähigkeit, Bedürfnisse (etwa zur Erlangung späterer, höherwertiger
Ziele) aufzuschieben, ist nicht vorhanden; sie müssen sofort befriedigt werden.
Es wird direkt auf die Umwelt reagiert. Dabei ist etwa das Wissen über Gefahren, die mit dem
eigenen Tun verbunden sind, nicht handlungsregulierend. Die Risiken werden während der Handlung
nicht bedacht, obwohl sie später benannt werden können.
Diese Art der Verhaltenssteuerung wird auch bei Streitigkeiten in den Kindergruppen
deutlich: Es besteht die Tendenz, erlittenes Unrecht sofort zu vergelten, ohne nach anderen
Konfliktlösungen zu suchen und ohne die Folgen für sich selbst zu bedenken. Gleiches gilt im
Übrigen beim Beistand für bedrängte Freunde.
Diese kindlichen Verhaltensstrukturen können von den Betreuern kaum beeinflusst werden, sie
brechen selbst bei sonst relativ rational bestimmtem Handeln immer wieder durch. Daraus leitet sich
für Betreiber und Mitarbeiter von Kindergärten sowie für Eltern die Verpflichtung ab, Gegenstände,
die zu Unfällen mit schweren Folgen führen könnten, von den Kindern fern zu halten.
Kinder sind mit etwa drei Jahren fähig,
Wettbewerbssituationen zu begreifen. Sie sind aber noch nicht in der Lage, Misserfolge in
derartigen Situationen adäquat zu ertragen. Ihre Frustrationstoleranz ist sehr gering, das
Selbstwertgefühl wird stark gemindert. Als Folge solcher Misserfolge brechen sie dann das begonnene
Spiel ab und gehen ihm in Zukunft möglichst aus dem Weg. Erst ab etwa fünf Jahren können sie mit
frustrierenden Situationen besser umgehen. Sie »flüchten« dann nicht mehr aus dem Spiel, sondern
versuchen, ihre Niederlage durch vermehrte Anstrengungen wettzumachen.
Für den Einsatz von Spielen, die Maßnahmen zur Sicherheitserziehung unterstützen können,
bedeutet das, dass man Spiele frühestens ab fünf Jahren in ihren Wettbewerbsvarianten
anbieten sollte. Im anderen Fall besteht die Gefahr, dass gerade die schwächeren und
jüngeren Kinder von den Spielen nicht profitieren können.
Die Aufmerksamkeit der Kinder zwischen drei und sechs Jahren hat ähnliche Strukturen wie
das Denken: Ein Aspekt einer Situation wird beachtet, alle anderen werden ignoriert. Dabei kann der
Schwerpunkt der Aufmerksamkeit äußerst schnell wechseln: Alles Neue und Auffallende zieht das Kind
an. Wenn ein Gegenstand in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist, wird die umgebende Situation
(mit all ihren Gefahren) nicht mehr beachtet. Bestes Beispiel ist der Ball, der aus dem Spielfeld
rollt und geholt werden muss. Die Aufmerksamkeit ist auf diesen und nicht auf die Umgebung (z.B.
schaukelndes Kind im Laufbereich, Straßenverkehr) gerichtet.
Für die Praxis in Kindergarten und Elternhaus ergibt sich aus der besonderen
Struktur der kindlichen Aufmerksamkeit:
Da Kinder ihre Aufmerksamkeit auf Neues, Auffallendes richten, sollten viele
neue, attraktive, sichere Spiele angeboten werden – attraktiver als bekannte, riskante Spiele.
Da die Aufmerksamkeit nicht teilbar ist, ist es wenig sinnvoll, während eines
laufenden Spiels Erklärungen über Gefahren zu geben. Die Aufmerksamkeit der Kinder ist in der Regel
auf das Spiel gerichtet. Besser sind Erläuterungen in Spielpausen bzw. vor oder nach dem
Spiel.
Ältere Kindergartenkinder sind (ähnlich wie bei der Denkentwicklung) fähig,
ihre Aufmerksamkeit auf mehr als einen Aspekt zu richten und somit Mehrfachhandlungen auszuführen.
Diese Entwicklung kann durch Spiele gefördert werden.
Hierzu als Beispiel eine Abwandlung
des Spiels Hexenmeister⮥:
Die Kinder laufen frei umher. Ein Kind ist der Hexenmeister.
Sagt es einen Zauberspruch, wird jedes Kind in das Tier verwandelt, das es sein will, und bewegt
sich entsprechend.
Wenn der Hexenmeister hingegen mit seinem Zauberbesen auf den Boden klopft,
stehen alle Kinder still und machen nur das Geräusch des gewählten Tieres nach. Klopft der
Hexenmeister aber mit dem Besen und sagt zusätzlich einen Zauberspruch, so müssen die Kinder
Bewegung und Geräusch der Tiere nachmachen. Die Signale wechseln sich dabei in freier Reihenfolge
ab. Nach fünf Zauberaktionen wird ein anderes Kind zum Hexenmeister und kann verzaubern – eventuell
in andere Tiere oder Gegenstände.
04h. Gefahrenbewusstsein
Eine Strategie der Sicherheitserziehung ist die Vermittlung von Wissen über
die Gefahren inner- und außerhalb des Kindergartens. Wichtig sind in diesem Zusammenhang vor allem
drei Fragen:
Welche Informationen über Gefahren besitzt ein Kind im Kindergartenalter im Normalfall?
Woher erhält es diese Informationen?
Wie wirkt sich Gefahrenwissen auf das konkrete Verhalten aus?
Zu diesen Fragen ist zu bemerken:
Gefahren können nur dann erkannt werden, wenn sie einen konkreten Bezug zum Kind
haben (z.B. ein [mit]erlebter Unfall). Noch nicht eingetretene Gefahren müssen sich zumindest auf
Situationen beziehen, die die Kinder gut kennen. Neue, nur abstrakt vorstellbare Gefahren können
Kinder nur sehr unzulänglich erkennen.
Wenn ein Kind an einem Unfall beteiligt war, beginnt es, die Gefahren zu erkennen,
die den Unfall bedingten. Durch den Unfall rücken die Gefahren, die dem Kind eventuell latent
bekannt waren, in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit. Der Unfall wird zum Anlass genommen, von sich
aus über die Gefahren nachzudenken.
Kinder, die unmittelbar an einem Unfall beteiligt waren, haben meist eine gute
Gefahrenkenntnis. Dies gilt vor allem dann, wenn sie schuldlos Opfer eines Unfalls wurden. War das
Verhalten des Kindes hingegen eine der Hauptursachen für das Zustandekommen des Unfalls, so ist es
in der Regel nicht fähig, seinen »Beitrag« zu erkennen. Es wird die Handlungen anderer oder den
Beitrag äußerer Umstände überschätzen und sein Verhalten bagatellisieren.
Auch Unfallzeugen sind potenziell in der Lage, das Gesehene zu analysieren und
dadurch Wissen über Gefahren zu erwerben. Häufig handelt es sich aber um »Knallzeugen«, die erst
durch den Unfallknall oder das Schreien des Verunfallten auf das Geschehen aufmerksam wurden. Bei
diesen fehlt die genaue Beobachtung des Unfallablaufs und damit die Grundlage einer Analyse.
Im Laufe eines spannenden Spiels ist die volle Aufmerksamkeit auf das Spielgeschehen
gerichtet. Es ist den Kindern hier nicht möglich, vorhandenes Gefahrenwissen anzuwenden. Auch
Erklärungen von Gefahren im Laufe eines Spiels führen zu keinem Erfolg. Erst nach Beendigung des
Spiels, mit einiger Distanz, können die Kinder die Gefahren ihres eigenen Spiels benennen.
Kinder neigen dazu, bestimmte Gefahren zu überschätzen und andere zu verharmlosen. So
wird die Gefahr durch Schläge anderer Kinder oder materielle Unfallursachen (z.B. durch den Stein,
über den man gestolpert ist) stark überbewertet, während immaterielle Ursachen (die eigene
Geschwindigkeit) weniger beachtet werden. Von vielen Kindern werden im Übrigen Zufälle oder
magische Gründe (wie das »Gesetz der Serie«) als Unfallursachen herangezogen.
Das Gefahrenwissen bezieht sich in der Regel auf eine konkrete Situation. Eine
Übertragung auf (für Erwachsene) vergleichbare Situationen findet nicht statt.
Für die praktische Arbeit ergeben sich hieraus folgende Notwendigkeiten:
 Eine Erklärung von Gefahren, die es nur außerhalb des Kindergartens oder des
Elternhauses gibt, ist wenig hilfreich. Hingegen sollte jeder Unfall, der sich im Kindergarten oder
im Freundeskreis der Kinder ereignet, zum Anlass genommen werden, mit den Kindern über die
zugehörigen Gefahren zu sprechen. Günstig ist es hier, den Verletzten oder Zeugen zu Wort kommen zu
lassen.
Eine Erklärung von Gefahren, die es nur außerhalb des Kindergartens oder des
Elternhauses gibt, ist wenig hilfreich. Hingegen sollte jeder Unfall, der sich im Kindergarten oder
im Freundeskreis der Kinder ereignet, zum Anlass genommen werden, mit den Kindern über die
zugehörigen Gefahren zu sprechen. Günstig ist es hier, den Verletzten oder Zeugen zu Wort kommen zu
lassen.
Spätere Erklärungen oder Ermahnungen sollten – wenn möglich – stets mit dem
Hinweis auf einen noch nicht lange zurückliegenden Unfall versehen werden (»Weißt du noch, wie
letzte Woche der Jens von der Rutschbahn gefallen ist«). Damit erhalten die Kinder ein
vorstellbares, konkretes Bild der Unfallsituation, das ihnen ein Erkennen der Gefahren
erleichtert.
|
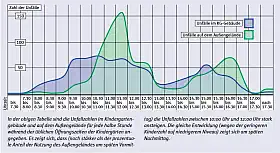 In der Tabelle sind die Unfallzahlen im Kindergartengebäude und auf dem Außengelände für jede halbe
Stunde während der üblichen Öffnungszeiten der Kindergärten angegeben.
In der Tabelle sind die Unfallzahlen im Kindergartengebäude und auf dem Außengelände für jede halbe
Stunde während der üblichen Öffnungszeiten der Kindergärten angegeben.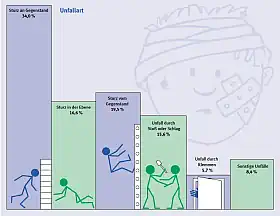 Der typische Kindergartenunfall ist ein Sturzunfall (ca. 70 %), der
meist zu Verletzungen im Kopfbereich führt. Diese Unfälle lassen sich zwar zum Teil durch
technische Maßnahmen wie die Beseitigung von Stolperstellen oder die Abpolsterung von Ecken
vermeiden. Wichtiger ist aber, die Kinder in die Lage zu versetzen, langfristig in einer weitgehend
nicht »abgepolsterten« Welt mit Risikosituationen zurechtzukommen.
Der typische Kindergartenunfall ist ein Sturzunfall (ca. 70 %), der
meist zu Verletzungen im Kopfbereich führt. Diese Unfälle lassen sich zwar zum Teil durch
technische Maßnahmen wie die Beseitigung von Stolperstellen oder die Abpolsterung von Ecken
vermeiden. Wichtiger ist aber, die Kinder in die Lage zu versetzen, langfristig in einer weitgehend
nicht »abgepolsterten« Welt mit Risikosituationen zurechtzukommen.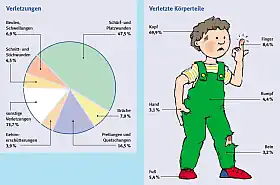 Gleiches gilt für die Gefahren des Straßenverkehrs. Zwar machen Wegeunfälle nur einen geringen Teil
der Kindergartenunfälle aus, sie führen aber häufiger zu schweren Folgen. Die Fähigkeit, sich
sicher im Straßenverkehr zu bewegen, wird auch im Freizeitbereich häufig benötigt, sodass die
Verkehrserziehung als ein wichtiges Teilgebiet der Sicherheitserziehung anzusehen ist.
Gleiches gilt für die Gefahren des Straßenverkehrs. Zwar machen Wegeunfälle nur einen geringen Teil
der Kindergartenunfälle aus, sie führen aber häufiger zu schweren Folgen. Die Fähigkeit, sich
sicher im Straßenverkehr zu bewegen, wird auch im Freizeitbereich häufig benötigt, sodass die
Verkehrserziehung als ein wichtiges Teilgebiet der Sicherheitserziehung anzusehen ist.
 Die motorischen und sensorischen Fähigkeiten von Kindern gelten häufig als Bereiche, die sich – im
Gegensatz etwa zur Kognition – »von selbst« entwickeln und somit in pädagogischen Einrichtungen
nicht gezielt gefördert werden müssen. Dabei wird übersehen, dass heute viele Kinder in einer
Umgebung aufwachsen, in der die normale Bewegungsentwicklung stark eingeschränkt ist. So fehlen vor
allem gefahrlos erreichbare Bewegungsräume im näheren Wohnumfeld:
Die motorischen und sensorischen Fähigkeiten von Kindern gelten häufig als Bereiche, die sich – im
Gegensatz etwa zur Kognition – »von selbst« entwickeln und somit in pädagogischen Einrichtungen
nicht gezielt gefördert werden müssen. Dabei wird übersehen, dass heute viele Kinder in einer
Umgebung aufwachsen, in der die normale Bewegungsentwicklung stark eingeschränkt ist. So fehlen vor
allem gefahrlos erreichbare Bewegungsräume im näheren Wohnumfeld: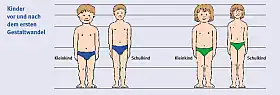
 Die Kraft (insbesondere in Armen und Beinen) verdoppelt sich etwa im Laufe des
Gestaltwandels.
Die Kraft (insbesondere in Armen und Beinen) verdoppelt sich etwa im Laufe des
Gestaltwandels. Die Schnelligkeit der Kinder steigt zwischen drei und sechs Jahren ebenfalls
stark an. Während sich die Schnelligkeit der Armbewegungen etwa verdoppelt, steigert sie sich beim
Laufen um ca. 30 %. Schnelligkeit wird zum Beispiel beim Überqueren von Straßen benötigt.
Die Schnelligkeit der Kinder steigt zwischen drei und sechs Jahren ebenfalls
stark an. Während sich die Schnelligkeit der Armbewegungen etwa verdoppelt, steigert sie sich beim
Laufen um ca. 30 %. Schnelligkeit wird zum Beispiel beim Überqueren von Straßen benötigt. Die Ausdauer ist bei den Kindergartenkindern bereits vorhanden.
Die Ausdauer ist bei den Kindergartenkindern bereits vorhanden. Das Gleichgewicht ist bei Kindern von drei bis vier Jahren noch äußerst gering
ausgeprägt – insbesondere, wenn die Kinder nicht sehen, wo sie gehen (z. B. im Dunkeln oder mit
verbundenen Augen). Im Laufe des Gestaltwandels verbessert sich der Gleichgewichtssinn etwa um das
Vierfache. Mangelndes Gleichgewicht ist eine Ursache vieler Sturzunfälle auf Rutschbahnen oder mit
Fahrrädern.
Das Gleichgewicht ist bei Kindern von drei bis vier Jahren noch äußerst gering
ausgeprägt – insbesondere, wenn die Kinder nicht sehen, wo sie gehen (z. B. im Dunkeln oder mit
verbundenen Augen). Im Laufe des Gestaltwandels verbessert sich der Gleichgewichtssinn etwa um das
Vierfache. Mangelndes Gleichgewicht ist eine Ursache vieler Sturzunfälle auf Rutschbahnen oder mit
Fahrrädern. Die Koordination der Bewegungen ist bei Eintritt in den Kindergarten noch sehr
gering ausgebildet. Sie steigt aber dann sehr stark an; so verbessert sich bei einigen Kindern die
Bewegungskoordination während des Gestaltwandels um das Achtfache. Die Bewegungskoordination ist
grundlegend für alle Bewegungen ohne »anzuecken« – insbesondere für das Ausführen von
Bewegungsfolgen in der richtigen Reihenfolge oder für parallele Handlungen. Sie ist auch für das
Verhalten im Straßenverkehr wichtig. So muss manchmal mitten in einer Vorwärtsbewegung abgestoppt
oder die Richtung gewechselt werden (wenn z. B. plötzlich ein Hindernis im Weg steht). Mangelnde
Bewegungskoordination ist eine Ursache vieler Zusammenstöße mit Personen oder Gegenständen.
Die Koordination der Bewegungen ist bei Eintritt in den Kindergarten noch sehr
gering ausgebildet. Sie steigt aber dann sehr stark an; so verbessert sich bei einigen Kindern die
Bewegungskoordination während des Gestaltwandels um das Achtfache. Die Bewegungskoordination ist
grundlegend für alle Bewegungen ohne »anzuecken« – insbesondere für das Ausführen von
Bewegungsfolgen in der richtigen Reihenfolge oder für parallele Handlungen. Sie ist auch für das
Verhalten im Straßenverkehr wichtig. So muss manchmal mitten in einer Vorwärtsbewegung abgestoppt
oder die Richtung gewechselt werden (wenn z. B. plötzlich ein Hindernis im Weg steht). Mangelnde
Bewegungskoordination ist eine Ursache vieler Zusammenstöße mit Personen oder Gegenständen.
 Richtiges Gehen ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es setzt aber eine
entsprechend ausgebildete Beinmuskulatur und ein entsprechendes Bewegungsmuster voraus. Die
jüngsten Kindergartenkinder mit ihrer schwachen Muskulatur und ihren kurzen Beinen gehen sehr
charakteristisch: Sie heben ihre Füße kaum an und setzen sie mit der ganzen Sohle auf. Sie stolpern
aus diesem Grund oft über kleinste Bodenunebenheiten.
Richtiges Gehen ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es setzt aber eine
entsprechend ausgebildete Beinmuskulatur und ein entsprechendes Bewegungsmuster voraus. Die
jüngsten Kindergartenkinder mit ihrer schwachen Muskulatur und ihren kurzen Beinen gehen sehr
charakteristisch: Sie heben ihre Füße kaum an und setzen sie mit der ganzen Sohle auf. Sie stolpern
aus diesem Grund oft über kleinste Bodenunebenheiten. Die Zielgenauigkeit beim Werfen nimmt in der Regel erst nach dem
Kindergartenalter deutlich zu.
Die Zielgenauigkeit beim Werfen nimmt in der Regel erst nach dem
Kindergartenalter deutlich zu. Kontrolliertes Landen hilft, schwere Folgen bei Stürzen zu vermeiden. Das
Abrollen kann im Normalfall erst von älteren Kindern erlernt werden. Zwar beherrschen schon die
meisten dreijährigen Kinder einen Purzelbaum; ein bewusstes Abrollen in Gefahrensituationen ist
aber erst ab fünf Jahren zu erwarten. Ein Einbau des Trainings dieser Fähigkeit in Spielhandlungen
ist schwierig. Anleitungen, wie diese Rolle erlernt werden kann, finden sich in der Sportliteratur.
Kontrolliertes Landen hilft, schwere Folgen bei Stürzen zu vermeiden. Das
Abrollen kann im Normalfall erst von älteren Kindern erlernt werden. Zwar beherrschen schon die
meisten dreijährigen Kinder einen Purzelbaum; ein bewusstes Abrollen in Gefahrensituationen ist
aber erst ab fünf Jahren zu erwarten. Ein Einbau des Trainings dieser Fähigkeit in Spielhandlungen
ist schwierig. Anleitungen, wie diese Rolle erlernt werden kann, finden sich in der Sportliteratur.
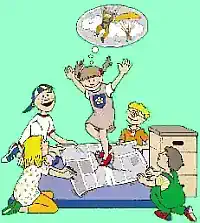 Spielregel: Die Kinder sitzen im Halbkreis und stellen sich vor, sie wären
Fallschirmspringer, die gleich nach und nach aus dem Flugzeug springen. An der offenen Seite des
Kreises hat man vorher einen erhöhten Standpunkt (Ausstiegsluke) mit einem Turnkasten (auch Bank
ist hier möglich) aufgebaut. Davor liegt eine Turnmatte oder Matratze (Wiese zum Landen). Die Höhe
des Kastens richtet sich nach dem Alter der Kinder. Das Spiel verläuft so, dass die Kinder nun der
Reihe nach würfeln. Hat eines eine ungerade Zahl geworfen, bedeutet das »Der Wind ist günstig zum
Absprung«. Es klettert zur Ausstiegsluke und springt durch das Wolkenpapier (bemalte oder unbemalte
Zeitung), das von zwei oder vier Kindern an den Ecken gehalten wird. Die Spielleiterin leistet auf
Wunsch Hilfestellung. Nach dem Sprung landet der Fallschirmspringer selbstverständlich auf der
Matte. Wer nicht durch die Wolken springen will, wartet, bis keine Wolke mehr da ist (Papier
wegnehmen).
Spielregel: Die Kinder sitzen im Halbkreis und stellen sich vor, sie wären
Fallschirmspringer, die gleich nach und nach aus dem Flugzeug springen. An der offenen Seite des
Kreises hat man vorher einen erhöhten Standpunkt (Ausstiegsluke) mit einem Turnkasten (auch Bank
ist hier möglich) aufgebaut. Davor liegt eine Turnmatte oder Matratze (Wiese zum Landen). Die Höhe
des Kastens richtet sich nach dem Alter der Kinder. Das Spiel verläuft so, dass die Kinder nun der
Reihe nach würfeln. Hat eines eine ungerade Zahl geworfen, bedeutet das »Der Wind ist günstig zum
Absprung«. Es klettert zur Ausstiegsluke und springt durch das Wolkenpapier (bemalte oder unbemalte
Zeitung), das von zwei oder vier Kindern an den Ecken gehalten wird. Die Spielleiterin leistet auf
Wunsch Hilfestellung. Nach dem Sprung landet der Fallschirmspringer selbstverständlich auf der
Matte. Wer nicht durch die Wolken springen will, wartet, bis keine Wolke mehr da ist (Papier
wegnehmen). Spielregel: Ein flacher »Bach« soll durchquert werden. Dabei kann man »Steine« (Pappscheiben)
zur Hilfe nehmen. Bei der Überquerung geht jeweils ein Kind über den »Bach«, der durch Striche auf
dem Boden markiert wird. In einer Proberunde werden die Steine in einer Schlangenlinie ausgelegt.
Die Kinder balancieren so zum anderen Ufer. Dann werden die »Steine« bis auf drei weggenommen. Nun
muss man auf zwei »Steinen« stehen und jeweils den Dritten mit der Hand weiterlegen.
Spielregel: Ein flacher »Bach« soll durchquert werden. Dabei kann man »Steine« (Pappscheiben)
zur Hilfe nehmen. Bei der Überquerung geht jeweils ein Kind über den »Bach«, der durch Striche auf
dem Boden markiert wird. In einer Proberunde werden die Steine in einer Schlangenlinie ausgelegt.
Die Kinder balancieren so zum anderen Ufer. Dann werden die »Steine« bis auf drei weggenommen. Nun
muss man auf zwei »Steinen« stehen und jeweils den Dritten mit der Hand weiterlegen. Vier Jahre alten Kindern wurde
das Modell einer Landschaft gezeigt, zunächst vom Blickpunkt 1 aus.
Vier Jahre alten Kindern wurde
das Modell einer Landschaft gezeigt, zunächst vom Blickpunkt 1 aus.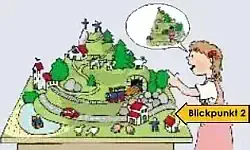 Anschließend zeigte man den Kindern die
Landschaft vom Blickpunkt 2 aus.
Anschließend zeigte man den Kindern die
Landschaft vom Blickpunkt 2 aus. Führte man sie aber anschließend wieder zum
Blickpunkt 1 zurück und bat sie, die Landschaft so zu beschreiben, wie sie eine andere Person
vom Blickpunkt 2 aus sieht, war dies den Kindern nicht möglich.
Führte man sie aber anschließend wieder zum
Blickpunkt 1 zurück und bat sie, die Landschaft so zu beschreiben, wie sie eine andere Person
vom Blickpunkt 2 aus sieht, war dies den Kindern nicht möglich. Zwei gleiche Gläser wurden mit der gleichen
Menge einer Flüssigkeit gefüllt.
Zwei gleiche Gläser wurden mit der gleichen
Menge einer Flüssigkeit gefüllt. Bildhaftes Denken ist nicht auf das Kindesalter
beschränkt, sondern tritt zuweilen auch bei Erwachsenen auf. Ein sehr hoher Anteil dieser Form des
Denkens ist aber ein weiteres Kennzeichen des präoperationalen Entwicklungsstadiums. Die Welt ist
für die Kinder noch nicht durch Symbole repräsentiert, sondern durch Bilder. Sichtbar wird dies,
wenn Kinder zählen sollen:
Bildhaftes Denken ist nicht auf das Kindesalter
beschränkt, sondern tritt zuweilen auch bei Erwachsenen auf. Ein sehr hoher Anteil dieser Form des
Denkens ist aber ein weiteres Kennzeichen des präoperationalen Entwicklungsstadiums. Die Welt ist
für die Kinder noch nicht durch Symbole repräsentiert, sondern durch Bilder. Sichtbar wird dies,
wenn Kinder zählen sollen: Kinder stecken oft unbekannte Dinge wie zum
Beispiel Beeren in den Mund oder trinken auch aus unbekannten Gefäßen (z.B. Spülmittelflaschen mit
Zitronen auf dem Etikett).
Kinder stecken oft unbekannte Dinge wie zum
Beispiel Beeren in den Mund oder trinken auch aus unbekannten Gefäßen (z.B. Spülmittelflaschen mit
Zitronen auf dem Etikett).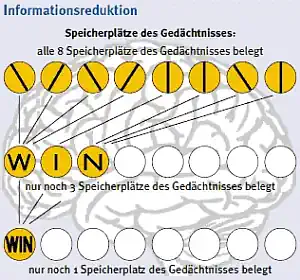


 Die Patienten sitzen im Kreis (Wartezimmer), ein Kind in der Mitte ist der Doktor, der die Wunden
seiner Patienten (mit Binden aus dem Kinder-Arztkoffer) versorgen soll.
Die Patienten sitzen im Kreis (Wartezimmer), ein Kind in der Mitte ist der Doktor, der die Wunden
seiner Patienten (mit Binden aus dem Kinder-Arztkoffer) versorgen soll. Hierzu ein Beispiel:
Hierzu ein Beispiel: Auch hierzu ein Beispiel:
Auch hierzu ein Beispiel: In der ersten Geschichte sieht ein Junge die
Mutter spülen und möchte ihr helfen. Dabei zerbrechen ihm versehentlich zehn Tassen. Der Junge in
der zweiten Geschichte wird von seiner Mutter gebeten, ihr zu helfen. Er hat aber keine Lust und
zerbricht aus Wut eine Tasse.
In der ersten Geschichte sieht ein Junge die
Mutter spülen und möchte ihr helfen. Dabei zerbrechen ihm versehentlich zehn Tassen. Der Junge in
der zweiten Geschichte wird von seiner Mutter gebeten, ihr zu helfen. Er hat aber keine Lust und
zerbricht aus Wut eine Tasse.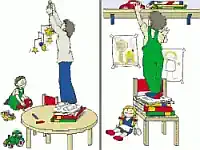 Im abgebildeten Beispiel beachtet die
Erzieherin nicht, dass das spielende Kind sie beobachtet, als sie für die Befestigung eines Mobiles
nicht die Leiter benutzt, sondern sich auf eine unsichere Unterlage stellt. Das Kind hat diese
Möglichkeit nun registriert.
Im abgebildeten Beispiel beachtet die
Erzieherin nicht, dass das spielende Kind sie beobachtet, als sie für die Befestigung eines Mobiles
nicht die Leiter benutzt, sondern sich auf eine unsichere Unterlage stellt. Das Kind hat diese
Möglichkeit nun registriert. Das abgebildete Kind weiß aus dem Kindergarten,
dass es die Rutschbahn nur sitzend hinabrutschen soll.
Das abgebildete Kind weiß aus dem Kindergarten,
dass es die Rutschbahn nur sitzend hinabrutschen soll. Das Kind versucht daraufhin einmal probeweise
das Rutschen auf dem Bauch. Es erleidet keinen Unfall, sondern landet weich im Sand. Das Rutschen
sorgt für etwas »Nervenkitzel«; zudem fühlt es sich mutig und anderen Kindern, die nicht so
rutschen wollen, überlegen.
Das Kind versucht daraufhin einmal probeweise
das Rutschen auf dem Bauch. Es erleidet keinen Unfall, sondern landet weich im Sand. Das Rutschen
sorgt für etwas »Nervenkitzel«; zudem fühlt es sich mutig und anderen Kindern, die nicht so
rutschen wollen, überlegen.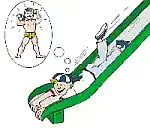 Der Erfolg führt dazu, dass das unsichere
Verhalten »auf dem Bauch die Rutschbahn hinabzurutschen« häufiger gezeigt wird – sich unter
Umständen sogar zu einer Gewohnheit entwickelt.
Der Erfolg führt dazu, dass das unsichere
Verhalten »auf dem Bauch die Rutschbahn hinabzurutschen« häufiger gezeigt wird – sich unter
Umständen sogar zu einer Gewohnheit entwickelt. Die ungefährlichste Art zu klettern ist die auf
dem Spielplatz auf niedrigen Klettergeräten, die über Fallschutzplatten montiert sind. Stürze sind
hier möglich, bleiben aber ohne ernste Folgen und zeigen dem Kind seine Fehler beim Klettern auf.
Haben die Kinder eine gewisse Geschicklichkeit erworben, kann auch einmal eine schwierigere (oft
äußerst attraktive) Aufgabe in Angriff genommen werden, zum Beispiel das Erklettern eines niedrigen
Obstbaums, der von Wiesen- oder Humusboden umgeben ist. Sind die Kinder motorisch geschickt, und
ist eine Erzieherin oder ein Elternteil in der Nähe, die im Falle von Angst eingreifen können, so
bleibt auch hier das Risiko kalkulierbar.
Die ungefährlichste Art zu klettern ist die auf
dem Spielplatz auf niedrigen Klettergeräten, die über Fallschutzplatten montiert sind. Stürze sind
hier möglich, bleiben aber ohne ernste Folgen und zeigen dem Kind seine Fehler beim Klettern auf.
Haben die Kinder eine gewisse Geschicklichkeit erworben, kann auch einmal eine schwierigere (oft
äußerst attraktive) Aufgabe in Angriff genommen werden, zum Beispiel das Erklettern eines niedrigen
Obstbaums, der von Wiesen- oder Humusboden umgeben ist. Sind die Kinder motorisch geschickt, und
ist eine Erzieherin oder ein Elternteil in der Nähe, die im Falle von Angst eingreifen können, so
bleibt auch hier das Risiko kalkulierbar.
 Um die praktische Arbeit in
Kindergarten oder Elternhaus zu erleichtern, werden in diesem Abschnitt die wichtigsten Anregungen
für eine effektive Sicherheitsförderung zusammengefasst:
Um die praktische Arbeit in
Kindergarten oder Elternhaus zu erleichtern, werden in diesem Abschnitt die wichtigsten Anregungen
für eine effektive Sicherheitsförderung zusammengefasst: Die vorhergehenden Kapitel haben gezeigt, dass Kinder ihre Sinnesfunktionen noch nicht ausreichend
koordinieren können. Ihr Konzentrationsvermögen ist eingeschränkt und ihre Reaktionszeit
verlangsamt. Hinzu kommt eine oft unzureichende Bewegungskoordination bei psychischer Anspannung
sowie ein noch nicht ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein.
Die vorhergehenden Kapitel haben gezeigt, dass Kinder ihre Sinnesfunktionen noch nicht ausreichend
koordinieren können. Ihr Konzentrationsvermögen ist eingeschränkt und ihre Reaktionszeit
verlangsamt. Hinzu kommt eine oft unzureichende Bewegungskoordination bei psychischer Anspannung
sowie ein noch nicht ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein.